II. DAS PHÄNOMEN
3. Mehr als nur
ein Genre
Beim Anblick von Auflistungen
aller vermeintlicher Kultfilme fällt auf, dass viele von ihnen sogenannten
Genres zugeordnet werden können. Es wurde bereits erwähnt, dass
der populäre Film sich durch die Verkörperung und Konstruktion
von Klischees auszeichnet. Struktur und Erzählung sind oft vorhersehbar,
lassen aber gleichzeitig Figuren undifferenziert. Dies ermöglicht
jedem Zuschauer, seine eigenen Phantasie und Vorstellungen praktisch in
den Film zu integrieren, wodurch er sich wesentlich besser mit ihm und
seinen Figuren identifizieren kann. Zudem kursieren innerhalb eines Genres
selten mehr als ein Duzend Grundgeschichten, die in der Vielzahl von Filmen
lediglich Variationen darstellen. Doch gerade dies gereicht dem Genre keineswegs
zum Nachteil.
„Im Gegenteil, die Lust
am Text (Bartes 1974) entsteht für die Zuschauer gerade durch das
„Wiedererkennen“ vertrauter Muster und durch das Zurechtfinden in einer
Filmwelt, deren Regeln und Gesetze sie kennen.“ (Winter 1992: 37)
Ein einzelner Film eines Genres kann
somit immer auch im Zusammenhang mit anderen gesehen. Bei Rezipienten,
die zuvor bereits viele dieser Filme konsumiert und mental verarbeitet
haben – Winter bezeichnet dies als „Kognitive Landkarte“ (1992: 39) – kann
sich die Bedeutung der Handlung dadurch radikal ändern. Es entsteht
also ein spezialisiertes Insiderpublikum: die Fangemeinde. Da von dieser
Eigenschaft des Genrefilms auch die Filmindustrie weiß, stimmen sie
ihre Produktionen auf die Erwartungen des Publikums ab, in der Annahme,
sich dadurch einen gewissen Erfolg zu garantieren oder zumindest die Wahrscheinlichkeit
eines solchen zu maximieren. So sind im Laufe der Filmgeschichte recht
schnell charakteristische Merkmale entstanden, mit denen sich ein Genre,
wie zum Beispiel Science-Fiction, Musical oder Gangsterfilm, relativ eindeutig
definieren lässt. Durch die so gewachsene Abhängigkeit des Produzenten
vom Publikum, bleibt ersterem gar nichts anderes übrig, als seine
Produkte den sozialen Verhältnissen der Fangemeinde sowie der Gesellschaft
an sich anzupassen.
„Jedes Genre hat einen
gleichsam religiösen Kern von Aussagen, die einen Sinnzusammenhang
darstellen und die man als seinen Mythos begreifen kann. In ihm verdichten
sich moralische Werte und kulturelle Normen einer Gesellschaft.“ (Winter/Eckert
1990: 81)
Abb. 14: Das Genre
als Prozess (nach Turner)
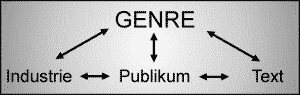 Zugleich
werden diese Normen aber auch von Filmen verschieden dargestellt und interpretiert,
was zu einem dynamischen Austauschprozess zwischen Produktion und Publikum
führt (siehe Abb.14). Beide beeinflussen durch ihre Erwartungen –
zum Teil auch voneinander – und Reaktionen die Handlungen von Filmen, die
wiederum in die nachfolgenden Produkte eingehen. Im Endeffekt bedeutet
dies, dass ein Genre kein starres Gebilde ist, sondern sich stetig weiterentwickelt,
wenn auch im Rahmen mehr oder weniger strenger Regeln. Zugleich
werden diese Normen aber auch von Filmen verschieden dargestellt und interpretiert,
was zu einem dynamischen Austauschprozess zwischen Produktion und Publikum
führt (siehe Abb.14). Beide beeinflussen durch ihre Erwartungen –
zum Teil auch voneinander – und Reaktionen die Handlungen von Filmen, die
wiederum in die nachfolgenden Produkte eingehen. Im Endeffekt bedeutet
dies, dass ein Genre kein starres Gebilde ist, sondern sich stetig weiterentwickelt,
wenn auch im Rahmen mehr oder weniger strenger Regeln.
Bei Kultfilmen allerdings, scheinen
diese Gesetze weit weniger stark zu gelten. Der bereits vorgestellte Film
„2001 – Odyssee im Weltraum“ zeichnet sich sogar gerade dadurch aus, dass
er sämtliche Regeln des bisherigen Science-Fiction-Genres ohne Zögern
bricht. Es gab keine lauten Gefechte und billige Effekte, sondern statt
dessen eine anspruchsvolle Handlung. In extremen Fällen wurden Genres
durch Kultfilme sogar gegründet – so geschehen bei der Schwarzen Serie.
Aufgrund dieser Überlegungen werden im weiteren Verlauf dieses Abschnitts
diese beiden Genres einmal genauer unter die Lupe genommen.
Durch die Konkurrenz des Fernsehens
zum Kino sind die großen Studios gezwungen gewesen, die Qualität
ihrer Filme permanent zu erhöhen. Waren zum Beispiel Science-Fiction-Filme
zunächst recht billige B-Streifen, zählen sie heute zu den aufwendigsten
und teuersten Produktionen ganz Hollywoods. Die Finanzierung erfolgt in
diesem Fall durch die große und vor allem treue Anhängerschaft
dieses Genres, bei der die Sichtung der neusten Produkte praktisch Pflicht
ist.
3.1.
Science-Fiction
Seit Beginn der Filmgeschichte
malen sich Filmemacher aus, wie es dem Menschen in der Zukunft ergehen
würde. Und mit Méliès’ „Reise zum Mond“ entstammte eine
der ersten Filmhandlungen überhaupt dem Bereich der Science-Fiction,
deren literarische Anfänge bis weit ins 18. Jahrhundert zurückreichen.
Es war die Zeit der Aufklärung. Die Wissenschaft sollte der Vernunft
Platz machen und den Aberglauben verdrängen, der den Menschen an der
freien Entfaltung hinderte. Die Entzauberung der Natur wurde angestrebt.
Von nun an sollte der Mensch die Kraft sein, die den Ton auf dem Planeten
angab.
„Die Vernunft hatte dabei
einen Kampf mit der Natur begonnen, der bis in unsere Gegenwart reicht
und der die entgültige Niederlange der Natur als negative Utopie produziert
hat.“ (Seeßlen 1980: 15)
Die Reiseliteratur der damaligen
Zeit war voll von Berichten und Erzählungen, wie mutige Pioniere wilde
Gegenden erkundeten und dabei noch viel wildere Tiere besiegten. So waren
die ersten echten Science-Fiction-Romane von Jules Verne, wie „Die Reise
zum Mond“ und „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“, dann auch Ausdrücke
des menschlichen Tatendrangs.
Doch relativ schnell reifte die
Erkenntnis, dass die Natur nur bedingt kontrolliert, aber viel eher völlig
zerstört werden würde, und es erschienen nun auch Personen auf
der Bühne der Literatur, die die technischen Wunderwerke der Menschen
hinterfragten. Mary Shellys „Frankenstein“ und Robert Louis Stevensons
„Dr. Jekyll und Mr. Hide“ haben weit weniger positive Visionen von der
Zukunft. Orson Wells benutzte die Science-Fiction in seinen Romanen „Die
Zeitmaschine“ dann schließlich als Kritik an der Gesellschaft, deren
Überheblichkeit bei seinem „Krieg der Welten“ lediglich durch einen
puren Zufall überlebte. (Die außerirdischen Invasoren scheiterten
letztlich an einem ordinären Grippevirus.)
„Science Fiction ist
die Couch, auf die sich die Gegenwart legt – mit all ihren Ängsten
und Hoffnungen, ihren Alpträumen und Sehnsüchten.“ (Körte
2001: 89)
Sie ist also gar nicht so sehr Zukunftsvision,
als vielmehr eine extreme Darstellung der gegenwärtigen soziokulturellen
Situation, die sich in den Themen verschiedener Kinofilme wiederspiegelt.
Ab 1920 fand in der Literatur mit der Gründung unzähliger Magazine,
die bis heute fast alleine den Begriff „trivial“ bestimmen, ein Boom statt,
der natürlich schnell auf die Filmindustrie übergriff, wobei
man sich immer an den Zeitgeist hielt. Fritz Lang traf mit seinem „Metropolis“
1924 genau die Ängste vor einer übermenschlichen Technik und
einem gesellschaftlichen Chaos, das schließlich im Zweiten Weltkrieg
aufging. In den 30ern konzentrierte sich Hollywood auf den mad scientist,
der mit seinen Erfindungen die Welt terrorisierte, während zehn Jahre
später Heerscharen von außerirdischen Invasoren in unsere heile
Welt einfielen. Waren europäischen Science-Fiction-Filme eher philosophisch
angehaucht waren, erkannte man in Hollywood bald deren visuellen Kräfte,
mit denen man Serials wie „Buck Rodgers“ oder „Flash Gordon“ verkaufte.
Mit dem Zweiten Weltkrieg vollführte
sich ein gewaltiger technischer Sprung, wodurch viele Visionen plötzlich
zur Realität wurden. Vor allem mit der Atombombe drängte sich
ein neuer Themenkomplex in die Science-Fiction.
„Fast schockartig kam
den Menschen dadurch zu Bewusstsein, dass man nun durchaus in der Lage
war, den eigenen Planeten zu zerstören.“ (Seeßlen 1980: 144)
Zusammen mit dem vermeintlichen Absturz
eines Ufos in Roswell 1947 begann eine sachliche Science-Fiction einzusetzen,
in der das Phantastische zurücktrat. Statt der Fiktion stand nun die
Wissenschaft im Vordergrund.
In den vergangenen einhundert
Jahren Filmgeschichte besaß die Science-Fiction also zum Teil radikal
unterschiedliche Schwerpunkte und zeichnet sich daher im Wiederspruch zu
den oben genannten Merkmalen eines Genres nicht durch ihre Armut, sondern
durch ihren Reichtum an Geschichten aus. So wurde (und wird) auch die Qualität
eines solchen Films nicht an den Kenntnissen des Autors am Genre gemessen,
sondern an dessen Originalität. (vgl. Seeßlen 1980:35) Viele
Autoren der Nachkriegszeit haben sich in ihrem Versuch, so wissenschaftlich
wie möglich zu sein, selbst zu viele Regeln gesetzt, so dass ihre
Phantasie an ihren eigenen Grenzen scheiterte. Zuweilen stehen Autoren
auch unter strenger Beobachtung ihrer Fans. So gibt es zum Beispiel Bücher
über „StarTrek“, in denen logische wie technische Fehler verzeichnet
stehen. In dieser Situation gedankliches Neuland zu betreten, erweist sich
als fast unmöglich. So halten sich durchschnittliche Autoren zumeist
an die folgenden drei Kategorien, die sich im Laufe der Zeit mehr oder
weniger herauskristallisiert haben:
· unkontrollierbare Technik
(Roboter, Mutanten, Monster,...)
· gesellschaftliche Utopien
(Kontrolle, Verelendung,...)
· Konfrontation mit der
Fremde (Invasionen)
Nur wenige Filme, die sich an
dieses Muster gehalten haben, wurden jedoch zu Kultfilmen. Viele B-Filme
der 50er und frühen Hollywoodgeschichte konnten statt dessen gegenüber
der heutigen perfekten Tricktechnik einen eigenen Charme entwickeln und
auf diesem Wege Kultstatus erreichen. In jüngerer Zeit gelang dies
nur Filmen, die eindeutig neue Wege bestritten oder Raum für eigene
Vorstellungen ließen, wie zum Beispiel „2001“.
„Wer sich gestern zu
viel ausgemalt hat, der blamiert sich morgen vor dem Verlauf der Geschichte
um so mehr. Wer sich dagegen zurückhält mit konkreten Utopien,
der kann auch heute noch einen Nerv treffen.“ (Körte 2001: 90)
Und eben dieser Nerv steht symptomatisch
für einen Kult. So konnte „Blade Runner“ (USA 1982) zunächst
kaum einen Kritiker über-zeugen und lief nur kleinen Programmkinos.
Doch seine brillante Komposition aus visuell einmaligen Bildern, der düsteren
Atmosphäre und den zwiespältigen Figuren ist bis heute unereicht.
(vgl. Brunner 1993: 91)
Ebenfalls durch beeindruckende
Effekte konnten Filme wie George Lucas’ „Krieg der Sterne“ oder Steven
Spielbergs „Die unheimliche Begegnung der Dritten Art“ (beide 1977) zu
Kultfilmen werden. Doch Effekte alleine reichten nie aus – es war stets
noch etwas mehr: Bei dem einen war es das märchenhafte Epos und beim
anderen waren die Außerirdischen erstmals freundlich gesinnt. Bis
dahin hatte es kaum positive Utopien gegeben (was sich seit damals auch
nicht geändert hat). Bei „Alien“ von Ridley Scott (1979) war es die
neuartige Verknüpfung von Horror und Raumschiff, die dem Zuschauer
den Atem stocken ließ.
Im digitalen Zeitalter sind derartige
Effekte nun relativ preisgünstig, so dass spektakuläre Materialschlachten
inzwischen zur Voraussetzung geworden und längst nicht mehr Garant
für kommerzielle Erfolge sind. Trotzdem scheinen immer seltener Kultfilme
aus diesem Genre hervorzugehen. Teilweise werden sie aufgrund ihrer Effekte
auch verkannt. Das „Starship Troopers“-Remake von 1997 wird bei Kritikern
häufig als banale Gewaltverherrlichung gebrandmarkt. Seine Fans jedoch
schätzten eher die brachiale Karikatur der amerikanischen Militär-
und Waffenkultur, bei der makellose Jugendliche als Kanonenfutter herhalten
müssen. Dass diese Gesellschaftskritik mit Paul Verhoeven als Regisseur
nur ein Europäer wagen konnte, würde ebenfalls eine soziologische
Betrachtung rechtfertigen.
3.2.
Hollywoods Schwarze Serie
Mit Beginn der 40er-Jahre kam
ein neuer Typus von Filmen in die Kinos, bei dem man bis heute nicht eindeutig
sagen kann, ob es sich dabei überhaupt um ein Genre handelt. Es war
der Beginn der sogenannten Schwarzen Serie, deren Stilistik man
auch vom französischen Film noir her kennt. Die Namen stehen
bezeichnend für die Atmosphäre dieser Filme, die alles andere
als eine heile Welt repräsentiert. Zumeist in Schwarz/Weiß gedreht,
werden die Bilder von dunklen Tönen dominiert, die beim Zuschauer
eine unerklärliche Beklemmung hervorrufen.
Seine Wurzeln hatte die Schwarze
Serie in den Gangsterfilmen der 30er, in denen der Gauner zum Mythos erhoben
wurde. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwammen zusehend - in
einer Gesellschaft, die zu jener Zeit in tiefster Depression steckte. Doch
der starke Wunsch nach Moral und Ordnung setzte diesen Filmen in Form des
bereits erwähnten Hays-Code ein Ende.
Bei der Schwarzen Serie
war der Zweite Weltkrieg der Auslöser, der Hollywoods Filmemacher
dazu bewegte, die vermeintlich harmonische Gesellschaft mit ihrer ebenso
fragwürdigen klaren Abgrenzungen zwischen Licht und Schatten in Zweifel
zu ziehen. Und so waren hier nicht mehr Gangster und Gauner, die ja eindeutig
auf der falschen Seite des Gesetzes stehen, die Hauptfiguren, sondern der
durchschnittliche Typ von nebenan, der zeitlebens unbemerkt seinen Beschäftigungen
nachgeht.
„Die Schwarze Serie bezeichnet
die bislang radikalste Absage an den American Way of Life und den
traditionellen Optimismus, die Hollywood hervorgebracht hat.“ (Gregor/Patalas
1973: 315)
Einfach alles, was den Amerikanern
lieb und teuer war, wurde in Frage gestellt. Und dies mit einem außerordentlichen
Auge fürs reale Milieu. Es herrschte ein profundes Misstrauen gegenüber
der gegenwärtigen sozialen Ordnung, in der schließlich trotz
allem Fortschritts der (bislang) gewaltigste Krieg und die größte
menschliche Katastrophe aller Zeiten ausbrechen konnte. Die Handlung eines
Films trat oftmals vollkommen in den Hintergrund und galt lediglich als
Mittel, um die dunklen Figuren in ihrem trostlosen Dasein einigermaßen
glaubwürdig zu verknüpfen. Zwar erschien zu diesem Zweck noch
immer der Kriminalfilm am geeignetesten, doch in ihm flossen nun Elemente
von Liebesfilmen, Gesellschaftsdramen und Thrillern ein. Letztendlich waren
es also die zerrütteten Figuren und die schwermütige Atmosphäre,
die dieses Genre ausmachten.
„Die Helden der Schwarzen
Serie waren die ersten Anti-Helden des Films, geborene Verlierer, die auf
bürgerliche Moralvorstellungen pfiffen, weil sie einfach zuviel Gemeinheit
und Schmutz gesehen hatten, um noch für irgend etwas „Gutes“ den Hals
zu riskieren.“ (Hahn/Jansen 1998: 522)
Die „Helden“ waren alles andere als
strahlende Ritter. Sie waren nicht einmal darauf aus, überhaupt jemanden
zu retten. Allein das Überleben war bereits ein Happy End. Die männlichen
Hauptfiguren hockten in kleinen, schmutzigen Appartements, rauchten und
tranken und hatten auch sonst nicht viel in ihrem Leben zustande gebracht.
In einer Welt, in der alles zugrunde zu gehen schien, bekamen auch die
Frauen eine neue Rolle. Sie standen nicht mehr hinterm puritanisch vorgeschriebenen
Herd und wurden nicht mehr unterwürfig dargestellt, sondern agierten
nun als raffinierte Intrigantinnen und skrupellose Mörderinnen, die
ihr wahres Gesicht hinter einer engelsgleichen Maske zu verstecken wussten.
„Die Themen der Schwarzen
Serie spiegeln ein Klima gesellschaftlicher Zerrüttung, das im Zerfall
von Familien, in hohen Scheidungsraten und steigender weiblicher Kriminalität
ebenso zum Ausdruck kommt wie in einem durch Kriegseinflüsse angeknacksten
männlichen Selbst-bewusstsein.“ (Heinzlmeier/Mennigen/Schulz 1988:
96)
All die oben genannten Stilelemente
sind vereint in „Die Spur des Falken“ (USA 1941), mit dem die Schwarze
Serie ihren Anfang nahm. Zugleich war es das Regiedebüt von John
Huston, der Humphrey Bogart als erster die Chance gab, sich als Hauptdarsteller
zu profilieren. Er spielt hier den Privatdetektiv Sam Spade - eine Rolle,
für die er wie geboren war und die selbst schon einen Kult begründete.
Spade hat eine Affäre mit der Frau seines Partners Miles Archer, der
eines Tages erschossen aufgefunden wird, nachdem er einen Auftrag der attraktiven
Brigid O’Shaughnessy (Mary Astor) angenommen hatte – offenbar legte auch
eher nicht allzu viel Wert auf die Ehe. Als Spade nun feststellt, dass
er ganz oben auf der Liste der Verdächtigen steht, versucht er, seinen
Kopf aus der Schlinge zu ziehen, wobei er auf die Spur einer goldenen Figur
stößt: der Malteserfalke. Im Verlauf der Ereignisse trifft er
mit einigen äußerst zwielichtigen Gesellen zu-sammen und verliebt
sich schließlich in die nicht weniger zwielichtige Brigid O’Shaughnessy.
Als am Ende der Deal mit dem Falken scheitert und auch der Sündenbock
für den Mord an Archer noch nicht gefunden ist, liefert Spade seine
Geliebte, die tatsächlich seinen Partner erschossen hatte, ohne zu
zögern an die Polizei aus. Die Liebe hat hier nicht den Hauch einer
Chance. Das einzige, was zählt, ist man selbst. (vgl. Hahn/Jansen
1998: 520-524)Egal mit
welcher Handlung einer jener Filme seine Botschaft transportierte, es waren
immer diese Anti-Helden, bei denen man bis zum Schluss nie so recht wusste,
woran man war. Inzwischen zählt beinahe jeder Film der Schwarzen
Serie zu den Klassikern der Filmgeschichte. Doch auch hier ist es wieder
mehr, was den Kult ausmacht. Solche Filme sind wie Schatzkisten mit doppeltem
Boden, unter denen der Zuschauer weit mehr entdecken kann, als man auf
den ersten Blick zu sehen glaubt.
Mit Eintritt der USA in den Zweiten
Weltkrieg wurde die Serie zeitweilig unterbrochen, doch als sich abzuzeichnen
begann, dass die Alliierten gewinnen würden, setzte man sie sogleich
fort. Sein abruptes Ende fand dieser Stil schließlich 1955 mit der
„Hexenjagd“ des McCarthy-Komitees. Derartiger Pessimismus schien einfach
nicht amerikanisch zu sein und konnte nur von Kommunisten stammen. Daher
war es kein Wunder, dass vor allem Humphrey Bogart sich dieser Hatz widersetzte,
schließlich starb mit der Schwarzen Serie auch seine Paraderolle,
bei der viele Insider behaupteten, er müsse sich dafür nicht
einmal verstellen.
Zwar gab es danach zumeist noch
einige klägliche Versuche, diesen Stil wiederzubeleben, doch sie alle
konnten die schwermütige Stimmung lediglich kopieren anstatt fortzuführen.
Nur dem bereits des öfteren erwähnten Science-Fiction-Films „Blade
Runner“ war es gelungen, sich den Titel Film noir redlich zu verdienen.
Auch wenn dies in einer gänzlich neuartigen Art und Weise geschah,
so waren hier doch alle Elemente wiederzufinden. Im Director’s Cut von
Ridley Scott fehlte sogar das Happy End, das aber schon in der ursprünglichen
Fassung nicht unbedingt eindeutig war. (vgl. Brunner 1993: 96) |